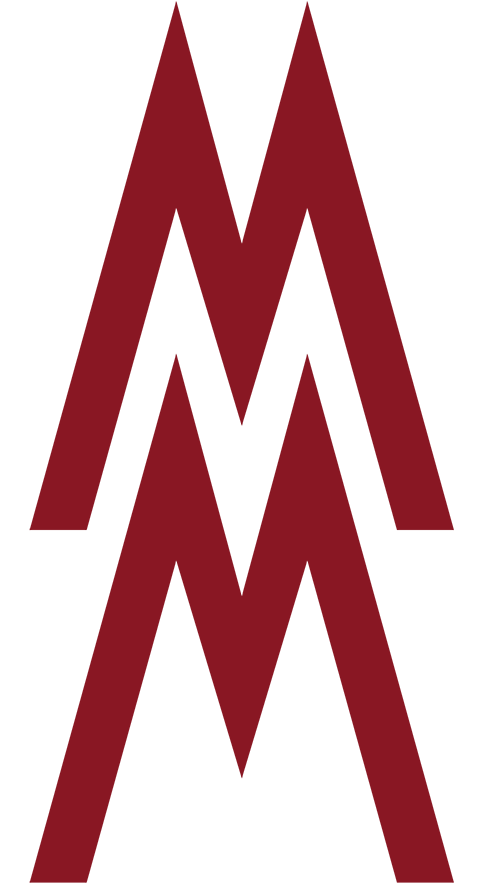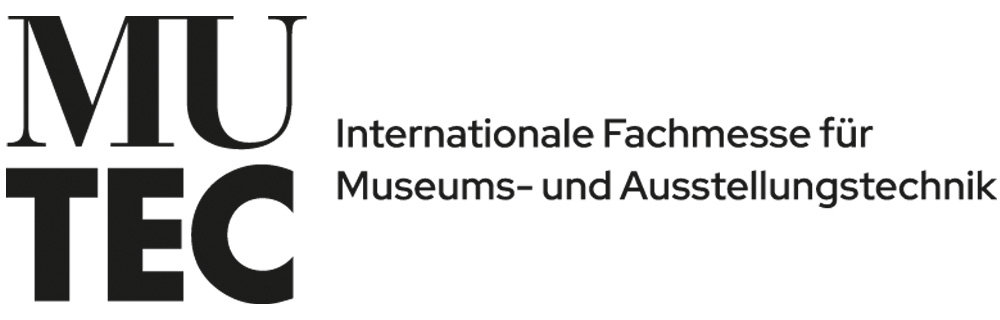News
News
Spannungsfeld der Gegenwart: das kulturelle Erbe der Kopenhagener Börse nach dem Brand
Der Brand der Alten Börse in Kopenhagen hat ein nationales Wahrzeichen zu 55 Prozent zerstört. Im nun beginnenden Wiederaufbau spiegelt sich eine bekannte Debatte der Denkmalpflege unter neuen, vielschichtigen Vorzeichen: Wie lässt sich die Rekonstruktion eines geschichtsträchtigen Bauwerks mit den Forderungen nach einem Baustopp aus Gründen der Nachhaltigkeit vereinen? Zwei Stimmen – die der Eigentümerin, der Dänischen Handelskammer, und die des Architekten und Professors für Nachhaltige Baukultur Nicolai Bo Andersen – zeigen, dass in Kopenhagen kulturelles Erbe und Klimakrise ausbalanciert werden müssen.
„Gilt Ihr gefordertes Moratorium für alle Neubauten, also auch für den Wiederaufbau der Börse?“ – Als Nicolai Bo Andersen, Professor für Nachhaltige Baukultur an der Königlich Dänischen Akademie, diese Frage hört, lacht er. „Natürlich“, antwortet er. Und fügt sofort hinzu: „Aber das ändert nichts daran, dass die Börse wiederaufgebaut werden muss.“
In diesem kurzen Moment bündelt sich die ganze Ambivalenz, die den Wiederaufbau – oder eben auch den Neubau - des 400 Jahre alten Gebäudes prägt. Einerseits steht die Alte Börse, unweit des Schlosses Christiansborg im Herzen Kopenhagens, für das nationale Selbstverständnis Dänemarks und seine Handelsgeschichte. Andererseits kann sie nun, nach dem verheerenden Brand vom 16. April 2024, als Paradebeispiel für die Frage herangezogen werden, wie sich Denkmalpflege, Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit miteinander vereinbaren lassen könnten.
Ein kulturelles, ein identitätsstiftendes Erbe
Für die Dänische Handelskammer, die seit 1857 Eigentümerin der Alten Börse ist, ist die Antwort klar. „Das Haus ist ein großer Teil unserer Identität“, sagt Christian Sestoft, Projektmanager der Kammer und zuständig für den Wiederaufbau der Börse. „Es war 400 Jahre lang Zentrum des Handels und des Gewerbes – und soll es auch in den nächsten 400 Jahren bleiben.“
Nur neun Tage nach dem Brand gab die Denkmalschutzbehörde bekannt, dass das Gebäude aufgrund seiner einzigartigen architektonischen Qualitäten, seiner bedeutenden kulturhistorischen Bedeutung und der Tatsache, dass 45 Prozent davon noch erhalten sind, weiterhin unter Denkmalschutz stehen wird.
Die Handelskammer trägt den Wiederaufbau ohne staatliche Unterstützung. Möglich macht das die Versicherung, die den Brand als Schadensfall anerkannt hat. Der Wiederaufbau bedarf der Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörden. Es wird erwartet, dass der Wiederaufbau in einer Form erfolgt, die der ursprünglichen Struktur des Gebäudes besser entspricht, da die zahlreichen Umbauten im Laufe der Zeit das Gebäude sowohl strukturell als auch architektonisch geschwächt hatten. Die Herausforderung am Wiederaufbau der Börse ist, dass es keinen wirklichen, klar zu definierenden Originalzustand gibt. Nach Angaben von Christian Sestoft soll der Wiederaufbau außen dem letzten Zustand entsprechen, während innen stärker an den ursprünglichen Plänen aus der Zeit Christians IV. angeknüpft wird. Die 886 Kiefern, die für den Wiederaufbau verwendet werden, stammen aus dem alten Königreich Christian IV., zu dem auch die schwedische Insel Gotland gehört. So soll die Authentizität gewährleistet werden. Im Inneren soll unter anderem die Große Halle im Obergeschoss restauriert werden.
„Kein Neubau ist nachhaltig“
Das Gespräch mit Christian Sestoft zeigt, wie wichtig der Wiederaufbau der Dänischen Handelsbörse ist. Nicht nur für die Kammer, sondern für Dänemark und seine Bevölkerung als solche. Doch Nicolai Bo Andersen stellt in diesem Zusammenhang eine grundsätzliche Frage: Was können wir uns in Zeiten, in denen sieben von neun planetarische Grenzen – wie Klimawandel, Integrität der Biosphäre oder die Veränderung der Landnutzung – überschritten wurden, noch leisten?
„Der Bausektor verursacht ein Drittel aller europäischen, energiebezogenen Emissionen und verbraucht bis zu der Hälfte aller Rohstoffe“, erklärt er. Kein Gebäude, das heute neu errichtet werde, könne ernsthaft als nachhaltig gelten. Stattdessen plädiert er für ein Moratorium: die meisten Neubauten in der westlichen Welt sollten ausgesetzt, bestehende Gebäude sollten besser genutzt, sorgfältig restauriert und so weit wie möglich umgebaut werden.
Diese Forderung entspringt nicht allein ökologischen Berechnungen, sondern auch einer ethischen Haltung. In seinem Artikel „Space Justice“ spricht Andersen von „Raumgerechtigkeit“: Wenn wir auf einem begrenzten Planeten die bebauten Flächen stetig erweitern, geschieht dies auf Kosten anderer – vor allem kommender Generationen. „Architektinnen und Architekten müssen lernen, mit dem Bestehenden zu arbeiten“, so Andersen.
Und doch widerspricht er nicht dem Wiederaufbau der Börse. Seine Position: Kulturelles Erbe hat eine Sonderstellung, weil es weit über reine Quadratmeter hinaus Bedeutung trägt. In seinem Text „Nach dem Brand“ argumentiert er: Gerade weil die Börse seit Jahrhunderten im Wandel war, müsse man den Wiederaufbau als Teil dieser Entwicklung begreifen – allerdings mit einer Strategie, die auf Wiederverwendung, sorgfältige Dokumentation und Respekt vor allen Zeitschichten setzt. Andersen schreibt: „Ich schlage einen ‚unsaubereren‘ Ansatz vor, der so viel Originalmaterial wie möglich wiederverwendet und das Beste aus den verschiedenen Epochen respektiert.“ Dieser Ansatz stehe auch im Einklang mit der Geschichte der Börse, die eben nicht die eine, absolute sei, sondern gerade durch ihren ständigen Wandel gekennzeichnet sei.
Christian Sestoft betont, dass sich bemüht wird, Nachhaltigkeit wo immer möglich zu berücksichtigen: Derzeit werden Ziegelsteine aus den Trümmern gereinigt, um sie im Gebäude wiederzuverwenden während das zerstörte Kupferdach nach Finnland geschickt wurde, um es dort zu recyclen.
Zwischen Erbe und Zukunft
Damit berührt Andersen eine Kernfrage der Denkmalpflege: Was ist eigentlich „das Original“? Die Alte Börse hat in ihrer 400-jährigen Geschichte mehrere tiefgreifende Umbauten erlebt Beispielsweise wurde die Fassade Ende des 19. Jahrhunderts mit neuen Ziegeln renoviert., das Erscheinungsbild damit grundlegend verändert.
Während der Wiederaufbau von Notre-Dame in Paris – mit der fast exakten Rekonstruktion des Zustands unmittelbar vor dem Brand – vergleichsweise „einfach“ war, ist die Situation in Kopenhagen komplexer. Hier soll nicht nur ein verlorener Zustand zurückgewonnen, sondern ein vielschichtiges Bauwerk weitergeschrieben werden.
Im internationalen Austausch, etwa mit den Restaurierungsteams von Notre Dame in Paris oder auch im Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Handwerkskammer zu Leipzig, sucht die Dänische Handelskammer nach Antworten, wie Rekonstruktion im 21. Jahrhundert gelingen kann.
Und vielleicht ist es gerade dieser Widerspruch, der die Börse zum Symbol macht: Sie wird erneut als „historisch“ gelten, obwohl sie ein teilweiser Neubau ist. Sie wird Energie und Rohstoffe verbrauchen und gleichzeitig Teil einer Tradition sein, die sich auch für ein nachhaltigeres Bauen inspirierend nutzen lässt.
„Nicht die Einheit des Stils ist entscheidend“, schreibt Andersen, „sondern die Gesamtwirkung, die Atmosphäre, die uns bewegt und uns bewusst macht, Teil einer größeren Geschichte zu sein.“ und bewegt sich damit ganz im Einklang zu einer Aussage, die er im Telefonat tätigt. Denn die größere Geschichte, die die Menschheit nun schreiben muss, scheint heute ihr Umgang mit der einsetzenden Klimakatastrophe zu sein. Andersens Ansatz, auch in der Lehre seiner Studentinnen und Studenten, ist es, vom Wissen alter Gebäude zu lernen. Denn Nachhaltigkeit und der Respekt vor den planetaren Grenzen ist in deren Mauern oftmals schon zu finden. Mit der bereits einsetzenden Klimakatastrophe gelte es heute, dieses Wissen aufs Neue zu lernen. Er sagt: „Kulturelles Erbe ist für mich eine Quelle der Inspiration für eine künftige Kultur des nachhaltigen Bauens.“ Der Wiederaufbau – oder eben der teilweise Neubau – der Alten Börse Kopenhagens scheint mit dieser Geisteshaltung eingeleitet zu sein. So widersprüchlich das auch anmuten mag.