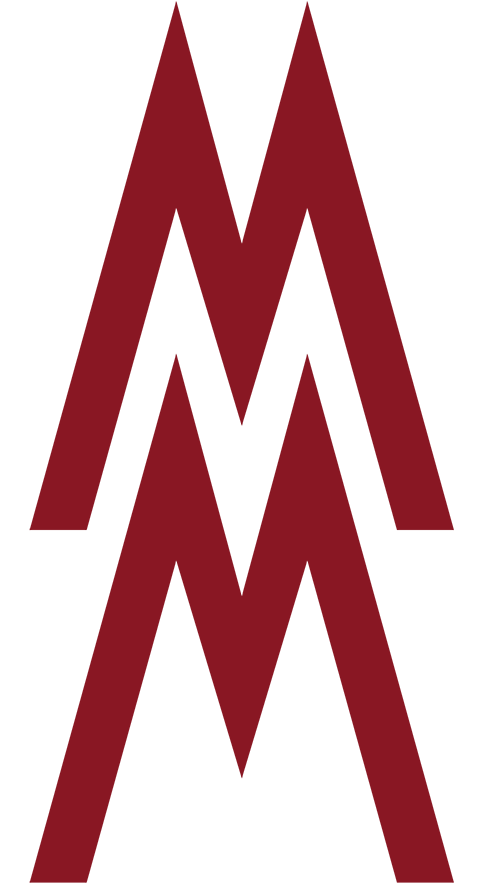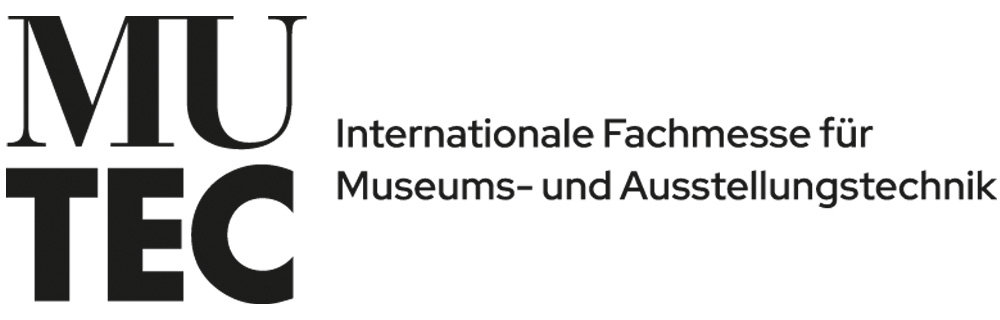News
News
Spurensuche im Grünen – Leipziger Parks im Wandel der Zeit
In der öffentlichen Debatte über den Denkmalschutz werden sie oft vergessen, doch auch sie können Denkmal sein: die Gärten und Parks. Leipzig, dessen Lebensqualität sich auch und insbesondere durch sein Grün auszeichnet, hat davon einige zu bieten. Mehr noch, sie geben Aufschluss über einige Meilensteine der Geschichte der Stadt und des Landes. Entdecken Sie mit uns auf einem kleinen Streifzug das grüne Leipzig und den einen oder anderen, vielleicht bislang unbekannten, historischen Fakt.
In Gedenken an einen Humanisten der Psychiatrie – der Güntz-Park
Beginnen wir im Leipziger Stadtteil Stötteritz des 19. Jahrhunderts, damals noch Thonberg, im Osten der Stadt gelegen. Der Psychiater Dr. Eduard Wilhelm Güntz, gründet dort im Jahr 1839 eine psychiatrische, stationäre Klinik. Güntz zielte mit seiner privaten Anstalt auf gut betuchte Bürgerinnen und Bürger, die sich die Versorgung leisten konnten. Er wollte alternativ zur damaligen, öffentlichen Versorgung eine umfassende und stärker an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten ausgerichtete Form der Behandlung und Pflege erreichen. Das Feedback der sich ihm anvertrauenden Bürgerinnen und Bürger schien positiv auszufallen. Im Jahr 1886 stiften sie ihm einen ganzen Turm mitsamt Dankbarkeitsstein. Heute ist auf dem ehemaligen Gelände der Anstalt – ihr Betrieb wurde im Jahr 1920 eingestellt – der Güntz-Park oder auch Thonberg-Park zu finden. Park wie Turm stehen heute unter Denkmalschutz und erinnern an einen, der für Humanismus in der Psychiatrie einstand. Ein weiteres Werk erinnert übrigens an Güntz und auch der Park mit seinem Turm tauchen dort auf. Der Leipziger Autor Clemens Meyer webt die Geschichte der Anstalt und die nicht gerade denkmalgerechte Nutzung des Turms in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in seinem neuen Roman „Die Projektoren“ ein.


DER Kulturpark, benannt nach einer der großen Feministinnen – der Clara-Zetkin-Park
Wir bleiben aber noch kurz im 19. Jahrhundert und fahren weiter in die größte Parkanlage in der Mitte Leipzigs. Denn die ist benannt nach Clara Zetkin, geboren am 05. Juli 1857. Zunächst in der SPD, dann der USPD, später in der KPD aktiv war sie eine der ersten Frauen, die sich nach der Einführung des Frauenwahlrechts 1919 – da sind wir schon im 20. Jahrhundert - „Parlamentarierin“ nennen konnten. Als solche saß sie von 1920 bis 1933 im Reichstag der Weimarer Republik. Neben ihrem Eintreten für sozialistische und pazifistische Ziele kämpfte Zetkin unverbrüchlich für die Gleichstellung der Frauen. Ihrem Wirken ist mit dem Clara-Zetkin-Park, mitten in Leipzig gelegen, ein in seiner Fläche regelrecht monumentales Denkmal gesetzt. Die historischen Parterreflächen bilden ein besonderes Augenmerk in der Parkanlage. Erst kürzlich saniert, wurden sie Ende Juni diesen Jahres beim Tag der Architektur vorgestellt . Pflanzbänder und Schmuckbeete wurden neugestaltet und die Bepflanzung mit Blick auf längere Hitze- und Trockenphasen modernisiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!


Wer jedoch - naheliegender Weise - denkt, dass der Park zu DDR-Zeiten angelegt wurde, liegt falsch. Lediglich der Name wurde ihm im Jahr 1955 verliehen. Dass in den folgenden Jahren der Park mehr und mehr zum Kulturpark wurde, ist jedoch auf die gezielte Förderung eines Erholungsraums für die arbeitende Bevölkerung zurückzuführen. Schon die 1867 angelegte Pferderennbahn im damals noch sogenannten „Volksgarten im Scheibenholz“ – nur ein Teil des heutigen Clara-Zetkin-Parks – machte den Anfang. Der Musikpavillon folgte im Jahr 1912 und lädt noch heute zu Konzerten oder geselligen Miteinander im Biergarten. Seit 1955 lockt die Parkbühne im Sommer Bands und Fans zu Open-Air-Events. Das Schachzentrum wiederum wird noch heute in wunderschöner Umgebung betrieben. Seine prominente Lage verrät jedoch einiges über die SED-Diktatur. Denn der Anspruch der DDR-Führung war es, im Spiel der Könige weltweit auf den vorderen Plätzen zu rangieren und sich so zu profilieren. Niedrigschwellig erreichbar wie es ist, zeigt sich, dass der Denksport auch als „sozialistisches Bildungsinstrument“ verstanden wurde . Der Erziehungsauftrag und die Instrumentalisierung sind verschwunden, übrig bleibt der beliebteste Freizeit-, Erholungs- und Kulturpark Leipzig mitsamt zahlreichen Kulturangeboten und dem beliebten Corner-Spot auf der Sachsenbrücke. So wie es ist, hätte es Clara Zetkin womöglich gefallen.

Ein „unbequemes“ Denkmal – der Richard-Wagner-Hain
Nur ein kleines Stück nördlich vom Clara-Park, wie er umgangssprachlich genannt wird, liegt ein herausforderndes Denkmal. Die Stadt Leipzig nennt den mit einer Pergola, Terrassenmauern und Wasserbecken konzipierten Hain ein „unbequemes“ Denkmal . Denn benannt ist er nach Richard Wagner, dem Komponisten, der auf Grund seiner antisemitischen Einstellung regelmäßig für Kontroversen sorgt. Der Richard-Wagner-Hain selber wurde während des Nationalsozialismus gebaut, wenn auch während der Weimarer Republik konzipiert. Gustav Allinger war der Architekt, der für Entwurf und Bau des Hains die Verantwortung trug. Er selber machte als Präsident der deutschen Gesellschaft für Gartenkunst Karriere, in der sich Gartenarchitektinnen und -architekten zusammenfanden. In dieser Stellung und in der Uniform der SA gekleidet wandte er sich gegen Kolleginnen und Kollegen, die er als „politisch unzuverlässig“ erachtete.

Der am Westufer des Elsterflutbeckens gelegene Teil des Richard-Wagner-Hains mit seinen Becken, der großen, zum Elsterflutbecken hinunterführenden Treppe und den beiden Aussichtsterrassen wird heute von Trauerweiden gerahmt. Auf der Pergola rankt wilder Wein. Dieser Teil wird seit 2022 bis heute saniert. Auch am Ostufer des Elsterflutbeckens sollen Maßnahmen ergriffen werden. Dort sind es Mauerabschnitte und Treppenanlagen, die saniert werden müssen, um die Verkehrssicherheit zu erhalten. Wenn gerade nicht gebaut und saniert wird, dann wird der Richard-Wagner-Hain für Yoga-Sessions oder das Lesen in geruhsamer Atmosphäre genutzt, Familien und Freundeskreise finden sich zum Grillen zusammen oder die Studentinnen und Studenten der benachbarten Sportwissenschaftlichen Fakultät spielen Fußballtennis oder Spikeball gegeneinander und bringen Festivalatmosphäre ans Elsterflutbecken.

Vom kommunistischen Ehrenhain zum offenen Denkraum – der Mariannenpark
Zurück in den Osten der Stadt: Mitten im Leipziger Stadtteil Schönefeld liegt ein Parkabschnitt, der weit mehr ist als ein Ort der Erholung. Der Mariannenpark ist stiller Zeuge politischer Umbrüche und gesellschaftlicher Veränderungen . Ursprünglich als Wegeachse für eine geplante Straße angelegt, diente das Areal beim Bau des Parks in den Jahren 1913/14 zunächst rein funktionalen Zwecken. Doch in den 1970er Jahren wurde die durch den Park führende Tangente zum Ehrenhain für den bis 1933 als KPD-Vorsitzenden fungierenden und 1944 im Konzentrationslager Buchenwald ermordeten Ernst Thälmann umgestaltet.

Nach 1989 verlor der Gedenkort seine politische Bedeutung, viele Elemente wurden entfernt oder verfielen. Die Wege blieben, der Ort geriet in Vergessenheit – bis neue Herausforderungen wie Hitze, Trockenheit und Nutzungsverlust eine Umgestaltung notwendig machten.
Ab 2019 wurde unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft des ehemaligen Ehrenhains diskutiert. Das Ergebnis: eine denkmalgerechte Sanierung, die Geschichte bewahrt und zugleich neue Qualitäten schafft. Seit 2024 laden Sitzgelegenheiten, Spielangebote und blühende Gehölze zum Verweilen ein. Besonders ins Auge fallen Bodenplatten mit dem Wort „Frieden“ in verschiedenen Sprachen. Sie symbolisieren die Sprachvielfalt Schönefelds. Denn es ist gerade der Osten der Stadt, der von zahlreichen Menschen aus verschiedenen Kulturen und Sprachräumen bewohnt wird. Sie alle nutzen den Park heute zum Ruhen oder zum Spielen mit den Kindern. Der Stadt ist gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern eine echte Herausforderung gelungen: Einen Ort von seiner ideologischen Überfrachtung zu lösen und gleichzeitig Geschichte nicht zu vergessen.
Aber warum heißt der Mariannenpark Mariannenpark? Das liegt an der Verfügung der Baronesse Clara Hedwig von Eberstein auf und zu Schönefeld. Die von ihr ins Leben gerufene Mariannenstiftung unterstützte „unbemittelte Töchter“ von Beamten und Militärs . Zudem wünschte sich die Baronesse, dass das Feld, das neben der damals schon existierenden Lindenallee lag, in einen Park verwandelt werde. Drei Jahre nach ihrem Tod im Jahr 1900 entsprach der Schönefelder Gemeindevorstand ihrem Wunsch. Mit der Mariannenstiftung schloss er einen Erbpachtvertrag, gültig bis zum 31. Dezember 2010, um das Vorhaben umzusetzen. Der Vertrag sollte die Wirren des 20. Jahrhunderts jedoch nicht überdauern, 1949 geht der Grundbesitz der Mariannenstiftung an die Stadt Leipzig . Zuvor jedoch, schon 1931, kam der „Volkspark Schönefeld“ zu seinem heutigen Namen: Mariannenpark.