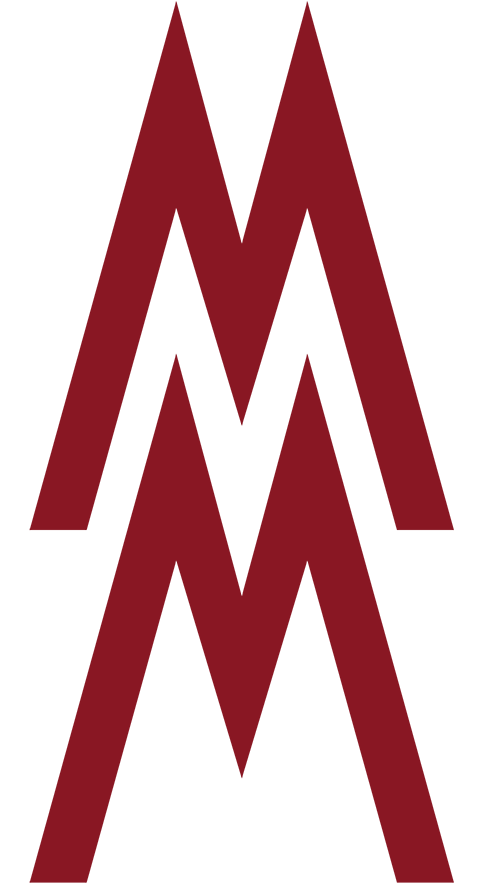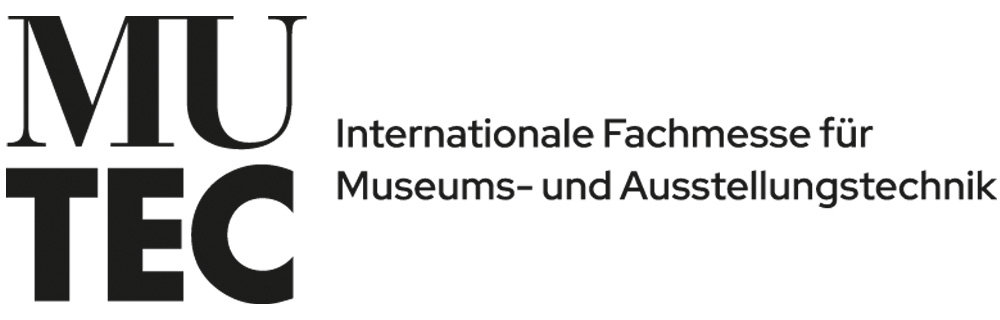News
News
50 Jahre Europäisches Denkmalschutzjahr – Auf den nächsten Schub Vernunft!
Ulrike Wendland, Geschäftsführerin des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, blickt im Interview mit dem denkmalbrief auf 50 Jahre Europäisches Denkmalschutzjahr zurück. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und wie sieht die Basis heute für die nächsten 50 Jahre Denkmalschutz aus?
Frau Wendland, 1973 wird das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz gegründet, 1975 erstmals das Europäische Denkmalschutzjahr ausgerufen, dessen 50-jähriges Jubiläum wir in diesem Jahr feiern. Dass es überhaupt stattfindet, geht auf einen Beschluss des Ministerkomitees des Europarats des Jahres 1972 zurück. Was war denn da in den 70ern los?
Wir befinden uns da in einer spannenden Entwicklung, die sich aus verschiedenen Strömungen speist. Der Furor des Wiederaufbaus westdeutscher Städte nach dem Zweiten Weltkrieg kostete viel Bausubstanz. Vieles, was nicht zerstört wurde, wurde einfach abgerissen. Zudem erschien 1972 der weltberühmte Bericht des Club of Rome, „Die Grenzen des Wachstums“. Der Bericht fokussiert zwar auf die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen, doch ist das Thema nicht zu trennen von der gebauten Umwelt. Denken Sie allein an den Steinzerfall, der damals auf Grund des hohen Schwefelbefalls der Luft zu verzeichnen war. Die Ölkrise von 1973 im Zuge des Yom-Kippur-Krieges führte zudem jedem und jeder Einzelnen vor Augen, wie angewiesen das moderne Leben auf fossile Ressourcen war und auch noch heute ist. All diesen Ereignissen voraus ging zudem die 68er-Bewegung, die sich auflehnten, zivilen Ungehorsam übten und unter anderem Häuser besetzten. Sie wehrten sich gegen die Verdrängung von Mietern in den Städten und steigende Mieten. Insgesamt wuchs das Bewusstsein für die Frage, wie das Leben in den Städten in Zeiten von endlichen Ressourcen und Wiederaufbau aussehen sollte. Mehr noch, dass es zu verhindern galt, dass sich ihre Städte bis zur Unkenntlichkeit verwandelten. Die bürgerschaftlich betriebene Kampagne „Haus für Haus stirbt dein Zuhause“ ist ein symptomatisches Beispiel für diese Zeit.
Sie beschreiben vor allem eine Veränderung in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Wie kommt es dann zu der Institutionalisierung dieser Wahrnehmung?
Meine Hypothese ist, dass diese Bewegung die Regierenden aufweckte und sie merkten, dass da Druck im Kessel ist. Ich denke, sie wollten wieder die Oberhand gewinnen, was auch mit zum Beschluss des Europarates führte. Das ist eines von vielen Beispielen, dass das bürgerschaftliche Engagement durchaus Erfolg hatte.
Auch das DNK ist ja ein Produkt des Europarats.
Ganz genau. Daher haben wir auch diesen etwas ungewöhnlichen Namen. In allen damaligen Mitgliedsstaaten des Europarats wurden nach dem Beschluss Nationale Komitees gegründet. Die meisten Komitees existieren inzwischen nicht mehr und sind in den Ministerien und Behörden der europäischen Staaten aufgegangen. In Deutschland haben wir mit dem Föderalismus die Besonderheit, dass der Denkmalschutz Sache der Länder ist. Das DNK befördert – angesiedelt beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien –den Austausch zwischen dem Bund und dem föderalen Gefüge.
Welchen Effekt haben all diese Maßnahmen vor 50 Jahren Ihrer Erkenntnis nach gezeigt?
Kampagnen und Pilotprojekte wie die Modellstädte waren wichtige Pionieraktivitäten. Immerhin haben wir immer noch keine ausreichend zufriedenstellenden Antworten auf diese damals wie heute existierenden Herausforderungen gefunden. Aber die 70er waren der Beginn eines Lernprozesses. Die Erkenntnis, dass wir auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder leben, führte damals zu vielen institutionalisierten Neuerungen. Gesamtgesellschaftlich wurde seither mehr und mehr versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie das Leben wieder ressourcenschonend gestaltet werden kann.
Wir sprachen schon über den Föderalismus– ist der beim Denkmalschutz ein Gewinn oder eine Last?
Durch den Föderalismus kommen Akteure aus unterschiedlichen Ebenen – Kommunen, Ländern und Bund – zusammen. Diese Mischung tut der Denkmalpflege gut, weil sie unter anderem die Diversität der Regionen berücksichtigt. Trotz der Hoheit der Länder spielt der Bund durch Rahmengesetzgebungen und vielfältige Förderungen des kulturellen Erbes eine einflussreiche Rolle in der Denkmalpflege. Kritisch zu sehen ist die sehr unterschiedliche Weiterentwicklung der Denkmalschutzgesetze – dieser Prozess macht es überregionalen Akteuren schwerer, die Spezifika zu verstehen und anzuwenden.
Sie sagten es schon – der Lernprozess der Gesellschaft, der vor 50 Jahren begann, ist längst noch nicht abgeschlossen. Benötigt es denn einen neuen Anstoß für eine aktivere Pflege des baulichen und archäologischen Erbes von deutscher oder europäischer Seite?
Von vielen Akteuren kommen heute deutliche Signale für den Bestandserhalt. Das reicht vom Netzwerk Anti-Abriss-Allianz über die Architects for Future, den Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA und viele weitere. Verstanden haben es im Grunde fast alle und sagen: Wir müssen im Bestand bauen und Materialressourcen anders nutzen. Ich setze besonders auf die junge Generation. Hochschullehrende erzählen mir, dass ihre Architektur-Studierenden nicht mehr an Projekte auf der grünen Wiese denken, sondern die Nutzung des Bestehenden lernen möchten. Schade ist es, wenn politisch der Rückwärtsgang eingelegt wird und damit Fortschritte in der Stadtentwicklungspolitik verhindert werden. Die autogerechte Stadt ist antiquiert. Städte, die auf die Rückeroberung des städtischen Raums für Fußgängerinnen und Fußgänger, ÖPNV und das Fahrrad setzen, stärken damit den Baubestand ihrer Zentren.
Welche Veränderungsnotwendigkeiten sehen Sie beim amtlichen Denkmalschutz?
Denkmalschutz ist Eingriffsverwaltung. Umbauten und Sanierungen an denkmalgeschützten Gebäuden stehen unter einem Erlaubnisvorbehalt. Das ist erstmal ein heftiger Eingriff in die Verfügungsgewalt von Eigentümerinnen und Eigentümern. Ein harsches behördliches Auftreten lassen sich heute aber immer weniger Bürgerinnen und Bürger gefallen. Da fällt mir der Begriff der Demut ein. Ich denke, im Sinne des Denkmalschutzes kann noch mehr erprobt werden, wie Denkmalschutz in kooperativer Kommunikation mit Denkmaleigentümern gelingen kann.
Wie blicken Sie auf die kommenden 50 Jahre Denkmalschutz?
Mit Zuversicht! Auch deshalb, weil die Gesellschaft über die denkmalpflegerischen Prinzipien der Reparatur den sparsamen Umgang mit Ressourcen lernen kann. Junge Leute haben heute andere Vorstellungen davon, was ein Denkmal ist. Da fallen auch Objekte darunter, die nicht alle Kriterien für Denkmäler erfüllen, die es aber als erhaltenswerte Bausubstanz zu schützen gilt. Heute besteht ein größeres Bewusstsein dafür, Material wiederzuverwenden und Stoffkreisläufe zu nutzen sowie die Bereitschaft, zu experimentieren. Die Basis für den Denkmalschutz ist solide genug, um ihn zeitgemäß modifiziert auch in den nächsten 50 Jahren erfolgreich fortzusetzen.
Vielleicht lässt sich abschließend sagen: zum 50. Jubiläum des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975 ist derzeit wieder viel Dynamik drin. Nun ist ein nächster Schub nötig, uns als Gesellschaft mit mehr Maß und Vernunft den Potenzialen des baulichen Erbes abermals zuzuwenden.